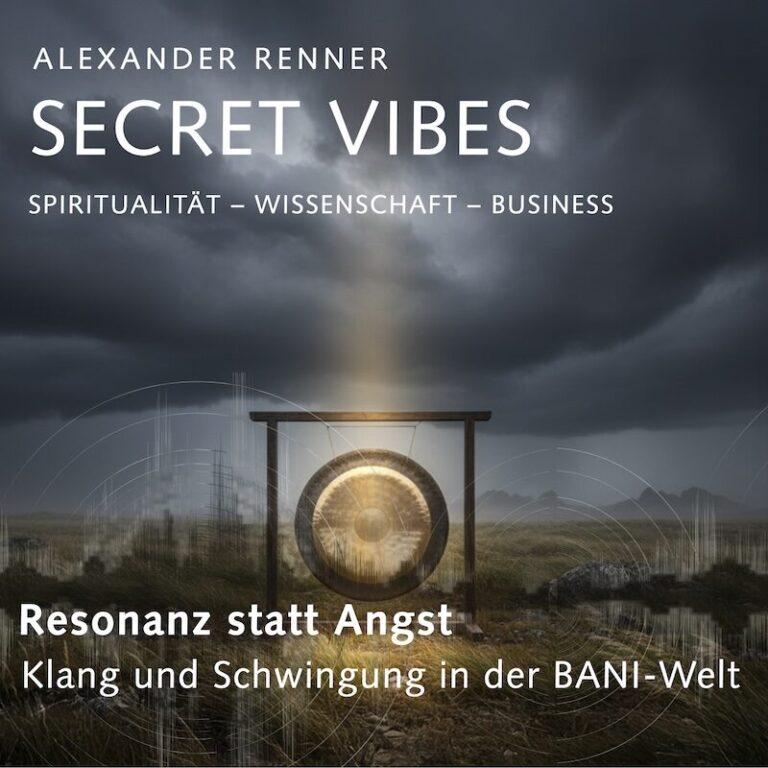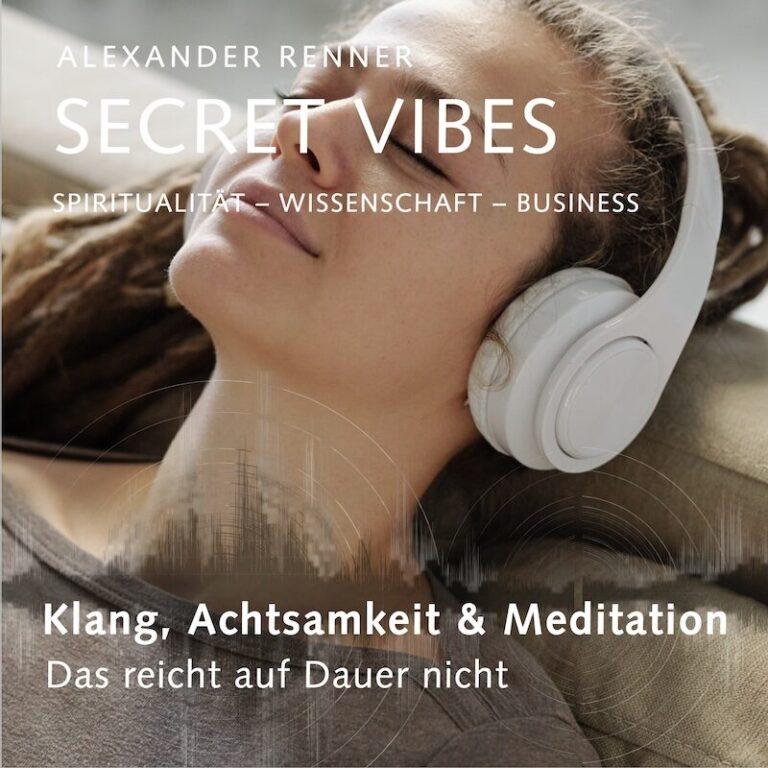Neurodiversität und Neurodivergenz – Klarheit über zwei zentrale Begriffe
Neurodiversität und Neurodivergenz – zwei Begriffe, die zunehmend in der Bildungs-, Gesundheits- und Arbeitswelt auftauchen. Doch obwohl sie eng miteinander verwandt sind, beschreiben sie unterschiedliche Konzepte. Wer sie verwechselt, riskiert Missverständnisse – in der Sprache wie in der Haltung.
Dieser Beitrag gibt einen präzisen Überblick über die beiden Begriffe, ihre Herkunft, Bedeutung und Anwendung im Alltag. Ziel ist es, eine sprachliche und inhaltliche Grundlage für ein differenziertes Verständnis neurologischer Vielfalt zu schaffen.
Was ist Neurodiversität?
Neurodiversität bezeichnet die natürliche Vielfalt neurologischer Funktionsweisen innerhalb der menschlichen Spezies. Der Begriff wurde in den 1990er Jahren von der Soziologin Judy Singer geprägt. Er steht für die Beobachtung, dass Menschen unterschiedlich denken, wahrnehmen und fühlen – ohne dass diese Unterschiede pathologisiert werden müssen.
Neurodiversität ist ein Konzept, das sowohl neurotypische als auch neurodivergente Menschen einschließt. Es geht dabei nicht um eine Diagnose, sondern um eine Perspektive: Vielfalt statt Defizit.

Was ist Neurodivergenz?
Neurodivergenz beschreibt die Tatsache, dass eine Person oder eine Gruppe neurologisch deutlich von der gesellschaftlich anerkannten Norm – dem sogenannten Neurotypischen – abweicht. Der Begriff wurde in den frühen 2000er-Jahren von der Aktivistin Kassiane Asasumasu eingeführt.
Typische Beispiele für neurodivergente Ausprägungen sind Autismus, ADHS, Dyslexie, Tourette, Dyspraxie oder auch Hochsensibilität. Neurodivergenz ist keine Bewertung, sondern eine Beschreibung – sie benennt eine neurologische Andersartigkeit.
Der Zusammenhang zwischen Neurodiversität und Neurodivergenz
Neurodiversität ist der übergeordnete Rahmen – sie beschreibt die Gesamtheit aller neurologischen Ausprägungen in einer Population.
Neurodivergenz ist eine Erscheinung innerhalb dieser Vielfalt – sie bezeichnet Menschen, deren neurologische Struktur nicht dem neurotypischen Standard entspricht.
Oder anders formuliert:
– Neurodiversität = die Vielfalt
– Neurodivergenz = das individuelle Anderssein innerhalb dieser Vielfalt

Warum diese Unterscheidung wichtig ist
Die präzise Verwendung dieser Begriffe hat praktische und ethische Relevanz:
– Wer Neurodivergenz meint, sollte nicht von Neurodiversität sprechen. Sonst wirkt es verwischt.
– Wer von Neurodiversität spricht, kann das gesamte Spektrum meinen – auch Menschen ohne diagnostizierbare Unterschiede.
– In Bildung, Arbeit und Therapie hilft die begriffliche Klarheit, Angebote zielgerichteter zu gestalten und Diskriminierung zu vermeiden.
Anwendungen im Alltag
– Ein Team ist neurodivers, wenn darin Menschen mit unterschiedlichen neurologischen Prägungen arbeiten.
– Eine einzelne Person ist neurodivergent, wenn sie z. B. mit ADHS oder Autismus lebt.
– Ein Kind, das mehr Pausen braucht, ist nicht „schwierig“, sondern möglicherweise neurodivergent.
– Eine Schule kann neurodiversitätssensibel sein, wenn sie strukturelle Reizüberflutung reduziert und klare Sprache verwendet.
Fazit
Neurodiversität und Neurodivergenz sind keine Modebegriffe – sie sind Schlüssel zu einer inklusiveren Gesellschaft. Wer sie versteht, schafft Räume, in denen Unterschiedlichkeit nicht nur sichtbar, sondern lebbar wird.
Sprache schafft Realität. Wenn wir klar benennen, was wir sehen, fördern wir nicht nur Verständnis – wir ermöglichen Teilhabe.